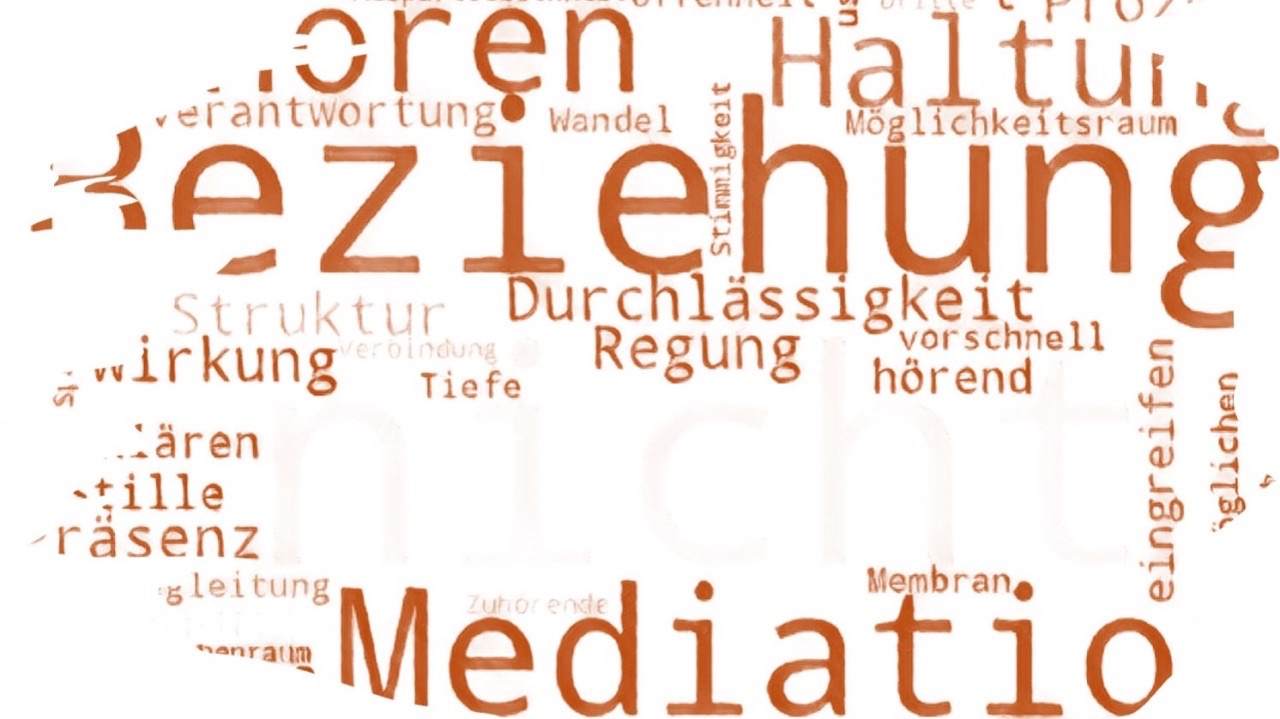Ein Essay über Zuhören, strukturelle Gewalt und die undurchlässige Membran
Ein Abend in Salzburg – und eine Offenlegung
Salzburger Festspiele 2025. Großer Saal der Stiftung Mozarteum.
Galina Ustwolskajas Duett für Violine und Klavier. Gespielt von Patricia Kopatchinskaja und Markus Hinterhäuser – mit einer Intensität, die nicht versöhnen will, sondern die Tiefe des Werks hörbar macht. Ihre Interpretation: kompromisslos, aufrichtig, durchdrungen von Präsenz. Es war keine Darstellung, sondern eine Offenlegung. [Aufnahme u. a. auf Streamingdiensten verfügbar.]
Der Titel mag Nähe suggerieren – doch was sich im Raum ausbreitet, ist ein Geflecht aus Spannung, Abbruch und Nicht‑Antwort. Zwei Instrumente, zwei Ausdruckswelten – und eine Beziehung, die konsequent nicht stattfindet.
Die Violine spricht, flackert, sucht – das Klavier: gesetzt, schwer, unerweichlich. Nicht im Widerspruch, sondern in einer anderen Ordnung.
Was bleibt, ist ein Dazwischen. Ein Raum, in dem Beziehung möglich gewesen wäre – und bewusst nicht entstand. Eine Wahrheit, die genau darin lag.
Und ich, Zuhörender: Ich war nicht Teil des Duetts – aber Teil des Raums, in dem etwas hörbar wurde.
Die Membran, die nicht durchlässig wird
Im Erleben dieses Konzerts wurde mir ein Bild deutlich: Zwischen dem, was gesagt wird – und dem, was gehört werden könnte – liegt manchmal eine Membran. Eine Grenze, die nicht laut ist, aber spürbar. Nicht aggressiv, aber undurchlässig.
In der Sprache des Ad_Monter Meta Modells:
Die Violine bewegt sich im Raum von c‑me – verletzlich, individuell, sinngetragen. Das Klavier agiert aus c‑it¹ – gesetzt, strukturiert, unberührt. Zwischen beiden liegt eine Membran, die in diesem Stück nicht durchlässig wird. Der Raum von c‑us, der sonst Vermittlung ermöglichen könnte, bleibt leer.
So entstehen zwei Seiten – getrennt durch Struktur, ohne Beziehung. Die Membran zwischen c‑me und c‑it¹ – Beziehung wird nicht hörbar. Diese Undurchlässigkeit ist es, die nicht nur musikalisch verstört, sondern in vielen sozialen Systemen wiederzuerkennen ist.
Ad_Monter Raute: Spannungsräume und Membranen im System – Membranen statt Mauern. Die Felder berühren sich; verbinden sich aber nicht immer.
Beobachtung zweiter Ordnung – und die stille Wirksamkeit
Ich hörte nicht nur das Stück. Ich hörte mein eigenes (Zu)Hören. Und dabei wurde mir bewusst: Ich bin nicht neutral.
Was macht mein Dasein mit dem Geschehen? Was macht mein inneres Bild mit dem, was ich beobachte? Und: Was zeigt sich in mir – gerade weil ich nicht eingreife?
Das ist keine Technik, sondern eine Haltung. Eine Haltung, die nicht vorschnell deutet, sondern das entstehen lässt, was noch nicht gesagt ist.
Die Haltung der Beobachtung zweiter Ordnung. Nicht: Was passiert da draußen? Sondern: Was geschieht in mir – und durch mich – im Kontakt mit dem Konfliktsystem, in dessen Spannungsfeld ich anwesend bin?
Mediation beginnt genau hier. Nicht in der Lösung, sondern im Raum davor. Nicht in der Einigung, sondern in der Bereitschaft, die Membran wahrzunehmen – nicht um sie zu durchbrechen, sondern um sie zu erspüren.
Wenn Governance zu Klang ohne Beziehung wird
Auch in Unternehmerfamilien zeigt sich diese Dynamik: Eine formale Ordnung, die spricht – gesetzt, legitimiert, vielleicht sogar wohlbegründet. Doch sie spricht nicht in Beziehung, sondern über Strukturen hinweg. Sie spricht aus dem Raum von c‑it¹.
Dem gegenüber: eine subjektive Regung, ein Anliegen, eine Sinnfrage – nicht irrational, sondern sinngetragen. Nicht formlos, sondern noch nicht eingeordnet. Sie spricht aus c‑me – verletzlich, tastend, beziehungsbedürftig.
Wenn aus diesen beiden kein Raum der Beziehung erwächst – wenn keine Resonanzfläche entsteht, kein gemeinsames Wahrnehmen, keine Vermittlung durch andere Stimmen, kein hörendes Drittes –, dann bleibt die Ordnung, wie sie ist: geschlossen.
Dann wird Governance zur Strukturgewalt – nicht nur durch ihre Härte, sondern auch durch ihre Undurchlässigkeit. Dann wird das Protokoll zur Partitur eines Klaviers, das nicht hört, was antworten möchte. Nicht, weil es böse wäre. Sondern weil die Membran verhärtet ist.
Beziehung wird dann nicht abgelehnt – sie wird schlicht nicht mehr möglich.
Mediation heißt mehr als Zuhören – aber beginnt genau dort
Mediation bedeutet nicht, Teil des Duetts zu werden. Sondern Teil des Raums, in dem Beziehung wieder möglich werden kann.
Nicht eingreifend im Sinne von Parteiwerdung. Nicht erklärend im Sinne vorschneller Lösung. Sondern: hörend präsent. Und damit: wirklich wirksam.
Dieses Zuhören ist nicht alles – aber ohne dieses Zuhören ist alles andere nichts. Es bildet das Fundament, auf dem Struktur, Prozess und Verständigung erst möglich werden.
Doch Zuhören ist kein trivialer Akt. Es reicht nicht, dem Konfliktsystem aufmerksam zu begegnen. Denn alles, was gehört wird, trifft auf ein eigenes inneres System: voll von Erfahrungen, Hypothesen, Bewertungen – nicht immer bewusst, aber wirksam.
Wirkliches Zuhören erfordert, auch das eigene (Zu)Hören zu hören. Beobachtung erster Ordnung – und zugleich: Beobachtung zweiter Ordnung. Nur so wird aus Resonanz eine Haltung, und aus Haltung ein Raum.
Mediation ist ein gestalteter Raum – aber ihre Wirksamkeit beginnt dort, wo jemand bereit ist, die Membran zwischen Struktur und Regung nicht sofort zu durchbrechen, sondern mit Haltung durchlässig zu machen – für das, was noch nicht gesprochen ist.
Zum Weiterdenken
- Wo in deinem beruflichen oder familiären Kontext spürst du eine undurchlässige Membran – zwischen Struktur und Person, zwischen Rolle und Regung?
- Und was verändert sich, wenn du zuhörst – nicht nur dem Anderen, sondern auch dir selbst beim Beobachten solcher Situationen?