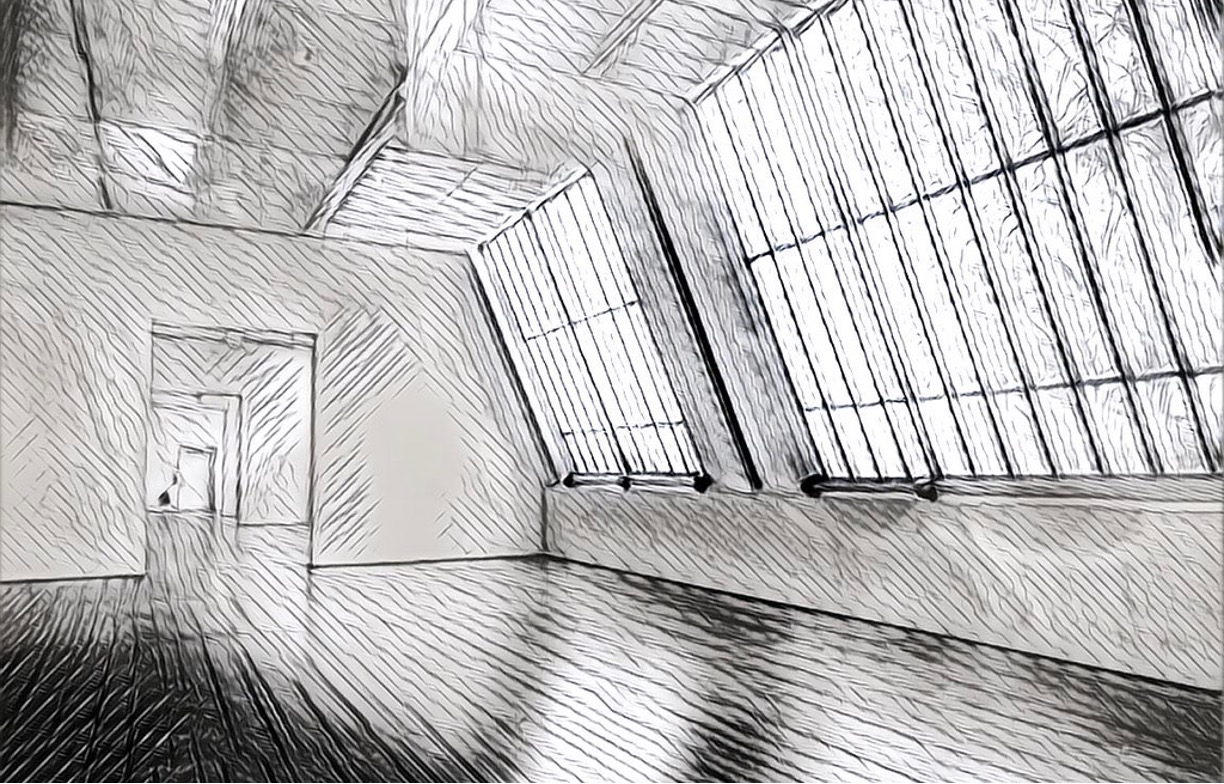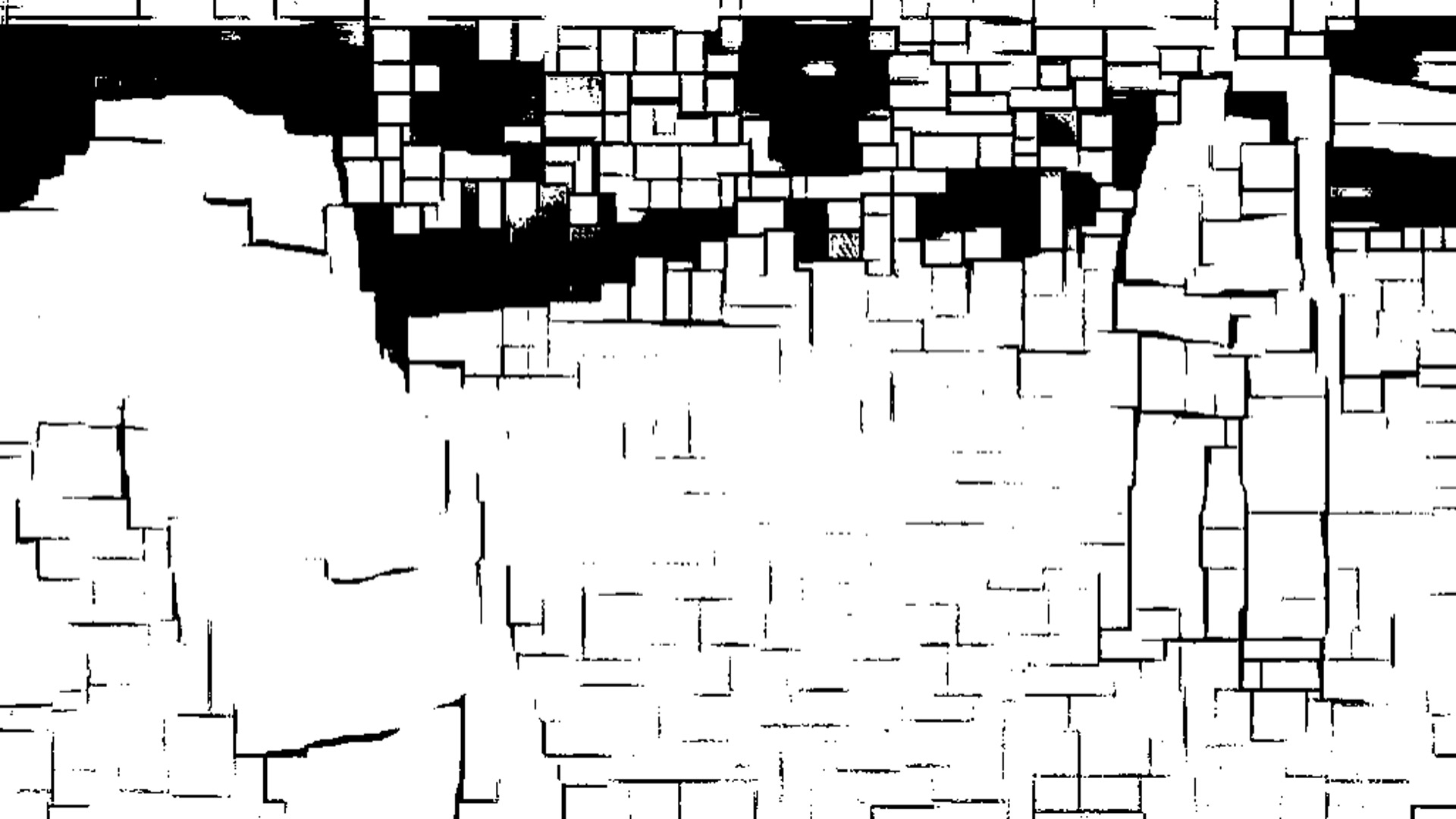Ein Mini-Dossier mit sechs Essays aus Haltung × Horizont.
Eine Einladung, Resonanz, Sprache und Verantwortung neu zu denken.
Inhalt
Cicero. Das Haupt auf der Rostra
Ein Essay über Redekultur, demokratische Haltung und die Frage, wessen Stimme zählt.
Ein Bild, das bleibt
Es gibt Bilder, die bleiben. Bilder, die sich nicht einbrennen wie ein Brandmal, sondern sich einlagern, wie eine Erinnerung, für die wir nie selbst Zeuge waren.
Das Haupt Ciceros, zur Schau gestellt auf der Rostra, dem römischen Rednerpult – abgeschlagen, entstellt, und doch: sprechender als viele Mäuler.
Stefan Zweig wählt diese Szene, um in seiner Miniatur „Cicero“[*] eine Sternstunde zu beschreiben, die keine glorreiche ist, sondern eine erschütternde. Kein Sieg, sondern ein Verlust. Kein Anfang, sondern ein Moment des Endes. Und dennoch: ein Bild, das bleibt.
[*] Stefan Zweig: Cicero. In: Sternstunden der Menschheit. Reclam, Stuttgart.
Der Redner gegen die Gewalt
Zweig erzählt nicht historisch, sondern verdichtet. In seiner Darstellung begegnet uns Cicero nicht als juristische Figur, sondern als tragender Gedanke.
Ein Mann, der für die Republik sprach, als diese schon gefallen war. Der glaubte, durch Worte zu halten, was durch Macht längst verschoben war. Der sich nicht in den Dienst des Neuen stellte, sondern das Alte zu retten versuchte – mit der einzigen Waffe, die er kannte: der Rede.
Antonius, sein Todfeind, verkörpert in Zweigs Erzählung die Gewalt, den Hohn, das rohe Gegenspiel zur denkenden Sprache. Er lässt Cicero jagen, entehren, entmenschlichen. Und als das Haupt auf der Rostra liegt, triumphiert nicht das Recht, sondern die Rache.
Doch Zweig lässt offen, ob es ein Triumph ist. Denn Cicero stirbt, ja. Aber seine Worte, seine Idee von Recht, Republik, Redekultur – sie leben weiter. Nicht trotz, sondern vielleicht wegen dieses Endes.
Wer darf sprechen – und wer wird gehört?
Was bedeutet das für uns heute? Wessen Kopf steht auf der Rostra unserer Zeit – wenn auch nicht physisch, so doch symbolisch? Wessen Stimme, wessen Gesicht, wessen Geschichte wird ausgestellt – und von wem?
In einer Öffentlichkeit, in der das Wort entwertet wird, in der Stimmen übertönt, ignoriert oder algorithmisch ausgeblendet werden, stellt sich die Frage neu: Wer darf sprechen? Wer wird gehört? Und: Wer hört zu?
In Familienunternehmen etwa ist „Rederecht“ kein formal geregelter Begriff, aber ein existenzieller. In Mediationsprozessen geht es oft nicht zuerst um Einigung, sondern darum, überhaupt wieder sprechen zu dürfen. Gehört zu werden. Und in politischen Institutionen? Da droht die Öffentlichkeit zur Kulisse zu werden, wenn die Rostra nur mehr von jenen bespielt wird, die die Sprache nicht zum Wohle aller, sondern zur Sicherung der eigenen Macht einsetzen.
„Demokratie beginnt nicht mit einer Wahl. Sondern mit dem Recht zu sprechen – und der Haltung, zuzuhören.“
Zwischen Rederecht und Schweigen
In beratenden Berufen, in der Konfliktbegleitung, in der Governance von Unternehmerfamilien erleben wir diese Fragen als alltägliche, nicht als antike. Wer darf sprechen? Wer fühlt sich sicher genug, um das zu sagen, was gesagt werden muss? Und wer sorgt für den Raum, in dem das möglich ist?
Der Tod Ciceros ist kein historisches Kuriosum. Er ist ein Spiegel. Für Systeme, die die Stimme fürchten. Für Machtstrukturen, die denken, durch das Verstummen anderer zu überleben.
Doch Worte sterben nicht mit jenen, die sie gesprochen haben. Wenn sie aus Haltung geboren sind, überleben sie ihre Zeit.
Das Wort als Spur
Am Ende steht kein Schlussstrich. Sondern ein offener Raum. Ciceros Haupt auf der Rostra ist kein Denkmal. Es ist ein Prüfstein – für uns. Für unsere Art, miteinander zu sprechen.
Wenn wir heute beraten, begleiten, führen oder zuhören, dann tun wir das in einer Welt, in der Worte zugleich Werkzeug und Risiko sind. Es braucht Mut, sich zu zeigen. Und Haltung, nicht sofort zu antworten.
Was wir sagen – und was wir verschweigen – hinterlässt Spuren. Die Frage ist: Welche wollen wir hinterlassen?
Reflexionsfragen
- Welche Stimmen kommen in meinen Entscheidungsräumen zu kurz – und warum?
- Wie gestalte ich Räume, in denen Reden nicht zur Repräsentationsgeste, sondern zur Verständigung wird?
- Welche Spuren hinterlässt mein Wort – in Familie, Organisation oder Öffentlichkeit?
Nächste Station: Hannah Arendt – Die Kraft des Anfangens. Ein Essay über Denken, Urteilskraft und die Verantwortung, die mit dem Sprechen beginnt.
Philosophie Bieri – nicht über das Leben, sondern mitten darin
Ein Essay über Menschenwürde, Selbstachtung und die Resonanz von Philosophie mitten im Leben.
Prolog – Eine Stimme im Halbschatten
Ich nahm seine Stimme einfach wahr. Nicht als „einfacher“ Zuhörer, sondern als jemand, der sich erinnern ließ, worauf es ankommt.
Peter Bieri sprach über Menschenwürde – nicht als Begriff, sondern als Lebensform. Und ganz nebenbei, in aller Unaufgeregtheit, zeigte er, warum wir nicht über das Leben philosophieren sollten – sondern mit ihm atmen müssen.
Ich hörte zu, erst beiläufig, dann gebannt. Nicht, weil ich etwas Neues lernte, sondern weil ich spürte, dass sich etwas Altes in mir wieder erinnern durfte.
Philosophieren heißt nicht, abstrakte Fragen zu stellen – sondern lebendig zu werden im eigenen Inneren.
Philosophie als innere Gegenwart
Es gibt Augenblicke im Leben, in denen alles still wird. Nicht äußerlich – da läuft die Welt weiter, ungerührt, geschäftig –, aber in uns: ein Moment des Innehaltens. Der Nebel im Kopf lichtet sich, nicht weil wir ihn bekämpfen, sondern weil wir aufhören, davonzulaufen.
Was bleibt, ist eine Frage. Oder ein Zittern. Oder ein leiser Satz: So kann ich nicht weiterleben. Oder: Das bin nicht ich. Oder einfach: Was ist das hier eigentlich?
Philosophie beginnt nicht mit Theorien, sondern mit solchen Momenten. Sie beginnt nicht am Rand des Lebens, sondern an seinem dichtesten Punkt. Nicht als Disziplin – sondern als Notwendigkeit.
Philosophie ist kein Wissen über das Leben – sie ist eine Form, im Leben aufzuwachen.
Würde: nicht gegeben, sondern geübt
Würde ist kein Besitz. Sie ist eine Haltung gegenüber sich selbst. Und diese Haltung braucht Pflege, Prüfung, Wiedervergewisserung.
Sie ist fragil – nicht, weil sie schwach wäre, sondern weil sie so tief mit unserem Selbstbild verwoben ist. Sie gerät ins Wanken, wenn wir uns selbst verraten, wenn wir aufhören, Grenzen zu setzen, wenn wir reden, wo wir besser geschwiegen hätten – oder schweigen, wo wir hätten sprechen müssen.
Würde heißt: Ich stehe zu mir, auch wenn ich allein stehe.
Wahrhaftigkeit – die leise Schwester der Würde
Nicht jedes Schweigen ist wahr. Und nicht jedes Reden ist mutig. Wahrhaftigkeit heißt nicht, alles zu sagen – sondern das Wesentliche nicht zu leugnen.
Bieri nennt das: „Eine dichte Lebensform – die nicht fortgerissen wird, auch nicht von innen.“
Zwischen Würde und Konflikt – ein konkret werdender Gedanke
Philosophie bleibt unvollständig, wenn sie sich dem Leben nicht zumutet. Und Mediation bleibt wirkungslos, wenn sie nicht anerkennt, dass Menschen im Konflikt oft vor einer viel tieferen Frage stehen als der, wer Recht hat.
Wer bin ich – in diesem Konflikt? Was steht für mich auf dem Spiel? Wo liegt mein Maß an Selbstachtung? Was will ich mit mir vereinbaren können – nicht nur mit dem anderen?
Konflikte kratzen nicht nur an Positionen. Sie erschüttern oft die innere Ordnung. Die Würde, die mir zusteht – oder die ich verloren zu haben glaube.
Würde im Konflikt heißt: nicht fortgerissen werden.
Selbstachtung als leise Fähigkeit
- Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen,
- nicht Opfer bleiben, wo Entscheidung möglich wäre,
- sich nicht entmündigen lassen – auch nicht durch die eigenen Emotionen.
Der Mediator oder die Mediatorin steht in solchen Momenten nicht über den Dingen, sondern daneben: als jemand, der Würde schützt, ohne Position zu ergreifen.
Selbstklärung als Resonanzraum
Was hilft? Die Wiederverbindung mit sich selbst. Der Raum für Selbstklärung – das Wiederfinden der inneren Stimme. Nicht als Taktik, sondern als Geltung. Nicht als Strategie, sondern als Selbstrespekt.
Die Würde der Mediand:innen liegt nicht im Sieg, sondern in der Möglichkeit, sich selbst in die Augen zu schauen – nach dem Konflikt.
Ein geschützter Moment zwischen dem, was war – und dem, was wieder möglich werden könnte.
Hannah Arendt – Die Kraft des Anfangens
Ein Essay über Verantwortung in Zeiten der Ungewissheit – und warum das Böse so gewöhnlich erscheinen kann.
Ein Gesicht im Gerichtssaal
Jerusalem, 1961.
In einem nüchternen Gerichtssaal sitzt eine Frau mit wachem Blick, den Notizblock in der Hand. Sie beobachtet einen Mann, der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht steht – und nicht wie ein Dämon wirkt, sondern wie ein Beamter, der auf Befehle verweist.
Hannah Arendt nennt ihn später „erschreckend normal“. Nicht, weil sie das Grauen verharmlosen will, sondern weil sie erkennt: Das wirklich Gefährliche ist nicht das radikal Böse, sondern das Denken im Modus des Gehorsams.
„Das erschreckende an der Gestalt war gerade seine Normalität.“
Arendt wird für diese Diagnose angefeindet. Aber sie hält fest: Wo das Denken aussetzt, kann das Unmenschliche zur Routine werden.
Verantwortung beginnt im Denken
Hannah Arendt unterscheidet radikal zwischen Wissen und Denken. Wer denkt, folgt keinem Befehl, keiner bloßen Logik – sondern stellt sich selbst infrage, befragt die Welt und sich darin. Verantwortung, so Arendt, entsteht nicht durch Regeln, sondern durch Urteilskraft:
„Urteilen heißt, sich an die Stelle eines anderen zu denken.“
In einer Welt, die komplex, zerbrechlich, ungeordnet ist, braucht es keine Technokraten des Richtigen, sondern Menschen, die bereit sind zu urteilen – und mit diesem Urteil sichtbar zu werden.
Das ist nicht bequem. Es bedeutet: zu handeln, bevor alle Informationen vorliegen. Und zu verantworten, was daraus wird.
Anfangen heißt: nicht wissen – und dennoch handeln
Im Denken Arendts ist der Anfang das politische Urereignis. In Vita activa schreibt sie:
„Der Sinn von Politik ist Freiheit. Und die Bedingung dieser Freiheit ist die Fähigkeit, etwas Neues zu beginnen.“
Anfangen heißt: die Kette der Wiederholung zu unterbrechen. Es heißt: nicht auf Sicherheit warten, sondern dem Ungewissen standhalten. Verantwortung zeigt sich genau dort – nicht im Funktionieren, sondern im Wagnis des Beginnens.
Zwischen Schweigen und Urteil – Räume für Verantwortung
Auch in unserer Zeit sind diese Fragen keine Theorie. In Familienunternehmen etwa beginnt echte Governance nicht mit Kontrolle, sondern mit Gespräch. In einem Mediationsprozess erzählte mir kürzlich ein Teilnehmer:
„Ich hatte seit Jahren eine Meinung. Aber erst jetzt habe ich das Gefühl, sie äußern zu dürfen.“
Das ist ein Anfang – kein spektakulärer, aber ein menschlicher. Und in einem Familienrat erklärte ein Vorstandsmitglied:
„Ich bin heute nicht hier, um zu überzeugen, sondern um zuzuhören. Vielleicht entsteht daraus etwas, das ich selbst noch nicht kenne.“
Auch das ist Verantwortung im Sinne Arendts: nicht als Besitz, sondern als Haltung. Nicht als Abschluss, sondern als Eröffnung.
Verantwortung ist auch eine Frage der Form
Nicht nur Personen, auch Organisationen treffen Entscheidungen. Die Strukturen, in denen kommuniziert wird, beeinflussen, was gesagt werden darf – und was nicht gehört wird. Verantwortung zeigt sich deshalb nicht nur im Einzelnen, sondern in der Form, wie Systeme miteinander umgehen. Wo nur entlang von Zuständigkeiten gesprochen wird, kann Denken zur Störung werden. Doch dort, wo Raum bleibt für den Zwischenruf, das Noch-nicht-Fertige, das Nicht-repräsentative, wird kollektive Urteilskraft möglich – und mit ihr eine neue Qualität von Verantwortung.
A_MMM-Bezug: Diese Qualität liegt zwischen c-me und c-us – dort, wo Selbstklärung in dialogische Verantwortung übergeht. Nicht als Methode, sondern als Haltung, die Anfang ermöglicht.
Die Banalität des Bösen – und die Kraft des Dialogs
Hannah Arendts Begriff der Banalität des Bösen wurde oft missverstanden. Sie meinte nicht: harmlos. Sondern: strukturell erschreckend. Das Böse braucht kein fanatisches Gesicht – es genügt, wenn Menschen aufhören zu denken, zu urteilen, zu widersprechen.
Dem setzt Arendt die Kraft des Dialogs entgegen. Nicht im Sinn des Konsenses – sondern als Raum, in dem Menschen sich zeigen. In dem Sprechen Verantwortung wird.
Vielleicht beginnt der Anfang, den Arendt meint, nicht mit einem Gedanken, sondern mit einem Ohr. Vielleicht liegt im Zuhören, im geduldigen Aushalten der Worte anderer, bereits der erste Schritt politischer Verantwortung.
Vielleicht sind es jene stillen Momente, in denen wir nicht antworten – und dennoch bleiben – die den Raum für das Neue bereiten.
Was daraus folgt? Das wird die nächste Ausgabe fragen. Vielleicht.
Reflexionsfragen
- Wo schweige ich aus Anpassung – und was verhindert das Anfangen?
- Welche Räume gestalte ich, in denen Verantwortung nicht delegiert, sondern geteilt wird?
- Wie gehe ich mit der Unsicherheit um, die jedem Anfang innewohnt?
- In welchen Situationen habe ich andere zum Denken eingeladen – statt ihnen eine Antwort zu geben?
Hinweis zu den Zitaten:
Die im Essay enthaltenen Zitate stammen aus folgenden Werken von Hannah Arendt:
Eichmann in Jerusalem – Ein Bericht von der Banalität des Bösen, Piper Verlag, 2022
Zur Zeit – Politische Essays, Piper Verlag, 2021
Vita activa oder Vom tätigen Leben, Piper Verlag, 2023
Mediation am Rand der Positionen – Ultima Thule
Ein Essay über Ultima Thule als Bild für den Resonanzraum der Mediation – und was es heißt, am Rand der Positionen Sprache neu zu finden.
Prolog – Das Bild von Ultima Thule
Als der griechische Seefahrer Pytheas von Massalia im 4. Jahrhundert v. Chr. in den Norden aufbrach, erzählte er von einem Land jenseits der bekannten Welt. Er nannte es Thule. Ein Ort im Nebel, vielleicht real, vielleicht nur ein Echo menschlicher Sehnsucht. Spätere Erzählungen verdichteten daraus Ultima Thule – das „äußerste Thule“: der Punkt, an dem die Karten enden und die Vorstellungskraft beginnt.
Unsere Gegenwart kennt solche Ränder. In Konflikten, in Politik und Gesellschaft. Wir bewegen uns sicher auf den Kartenteilen, die wir benannt haben: Positionen, Parolen, Programme. Und doch gibt es Zonen, in denen das Bekannte sich erschöpft. Mediation beginnt genau dort – am Rand der Positionen, im Weißraum zwischen den Linien.
1) Positionen als Karten der Gegenwart
Positionen sind notwendig. Sie bündeln Erfahrung, machen Orientierung möglich, geben Halt. Aber Positionen sind auch Grenzen: Linien, die Zugehörigkeit markieren und Abgrenzung befördern. Je härter die Zeiten, desto dicker werden diese Linien. Wer ihnen folgt, findet zunächst Sicherheit – und bald Enge.
Das Ergebnis: Erschöpfung statt Lösung. In öffentlichen Debatten passiert Ähnliches – nur lauter, sichtbarer, folgenreicher. Dann wird der Raum zwischen den Positionen zur weißen Fläche: unbetreten, unbenannt, aber voller Möglichkeiten. Ultima Thule ist die poetische Chiffre für diesen Raum.
Am Rand der Positionen verändert sich die Semantik: von Gewissheit zu Suchbewegung, von Festhalten zu Resonanz.
2) Mediation als Reise jenseits der bekannten Linien
- Aushalten: Der gemeinsame Raum wird nicht mit schnellen Deutungen gefüllt.
- Verlangsamen: Intensität wird nicht mit Lautstärke verwechselt.
- Fragen verschieben: Von „Wer hat recht?“ zu „Was steht für wen auf dem Spiel?“
- Resonanz zulassen: Das Gesagte wirkt nach – in der Person, im Blick des Gegenübers, im Raum dazwischen.
Mediation betrachtet Konflikte nicht wie Rätsel, die gelöst werden müssen, sondern wie ein Terrain, das erschlossen werden will. Dafür braucht es keinen Eroberungsplan, sondern einen Kompass.
3) Die Ad_Monter Raute als Kompass
Die Raute beschreibt vier Felder, die den Resonanzraum einer Verständigung strukturieren:
- c-it¹ – Orientierung im Bekannten: Daten, Begriffe, Zuständigkeiten – Nebelreduktion.
- c-me – Selbstklärung: Motive, Bedürfnisse, Befürchtungen sichtbar machen.
- c-us – Begegnung im Zwischenraum: Karten übereinanderlegen, Resonanz erzeugen.
- c-it² – Gestaltung im Neuland: Vereinbarungen, Sequenzen, erste Ordnung im weißen Raum.
Die Raute zwingt nicht in Linearität – sie eröffnet Bewegung am Rand, bis tragfähige Sprache entsteht.
4) Gesellschaftspolitische Dimension – Ultima Thule als demokratischer Horizont
Was in Mediation gilt, betrifft auch die Demokratie. Politische Gesellschaften leben von Positionen – und leiden zugleich an ihnen. Ultima Thule ist das Bild für jenen Raum, in dem Verständigung jenseits der Positionen möglich wird.
4.1 Klimakrise – das globale Ultima Thule
Die Klimakrise markiert ein Ende alter Karten. Vieles, was gestern Orientierung gab, trägt morgen nicht mehr. Die Debatte verhärtet sich – zwischen „Wachstum zuerst“ und „Degrowth“, zwischen „Technologie“ und „Verzicht“. Mediation bietet drei Verschiebungen:
- Von moralischer Eskalation zu geteilter Problembeschreibung (c-it¹).
- Von Gegenerzählungen zu koppelbaren Bildern (c-us).
- Von Totalpaketen zu sequenzieller Gestaltung (c-it²).
4.2 Machtfantasien politischer Führer – der binäre Sog
Autoritäre Inszenierungen leben von binären Dramaturgien: Freund/Feind, Sieg/Niederlage. Mediation ist hier Widerstand gegen den binären Sog – ein demokratisches Gegenmodell, das den Zwischenraum schützt.
4.3 Der weiße Raum als politische Aufgabe
Ultima Thule ist kein romantisches Außen, sondern eine Arbeitszumutung: epistemisch, affektiv, sozial, praktisch. Übertragen auf die Raute heißt das: Fakten klären (c-it¹), Selbstklärung zulassen (c-me), koppelbare Sprache entwickeln (c-us), sequenzielle Vereinbarungen gestalten (c-it²).
Der demokratische Horizont liegt nicht im Zentrum der Positionen, sondern an ihren Rändern.
5) Was Mediation als gesellschaftliche Praxis beitragen kann
- Klarheit der Ebenen: Fakten, Werte, Beziehungen und Maßnahmen nicht vermischen.
- Sprache der Kopplung: Begriffe als Brücken, nicht Barrikaden.
- Sequenzielle Vereinbarungen: kleine Schritte mit Rückkopplung, nicht Totalpakete.
6) Was die Ad_Monter Raute in polarisierter Zeit leistet
Analyse und Haltung zugleich: Sie trennt sauber die Ebenen – und lädt ein, am Rand zu bleiben, bis Sprache tragfähig wird.
Epilog – poetische Verdichtung
Vielleicht war Ultima Thule nie ein Ort. Vielleicht war es immer nur ein Wort für den Moment, in dem wir aufhören, die Welt mit alten Linien zu beruhigen.
Mediation führt uns dorthin. Nicht als Umarmung des Ungefähren, sondern als Kunst, im Ungefähren genau zu sein.
Ultima Thule ist kein Ende der Positionen – sondern ein Anfang der Beziehung.
Die offene Gesellschaft – und unsere Gesprächskultur
Ein Essay über Gesprächskultur, Resonanzräume und die Verteidigung der Offenheit in Zeiten der Zuspitzung.
Prolog – Gespräch als Resonanzraum
Wir leben in einer Zeit, in der Gespräche härter werden. Sätze sind zugespitzt, Positionen werden wie Schilde vor uns hergetragen. Der Rhythmus der sozialen Medien fördert Schnelligkeit und Zuspitzung, doch kaum Resonanz und Nachhall. Zuhören gilt fast schon als Schwäche, Innehalten als Zeitverlust.
Dabei entscheidet sich gerade im Gespräch, ob wir fähig bleiben, eine offene Gesellschaft zu leben – oder ob wir uns in kleine, abgeschlossene Lager zurückziehen.
Die Rede von der offenen Gesellschaft klingt groß, fast pathetisch. Doch im Kern ist sie etwas sehr Konkretes: die Fähigkeit, Unterschiede im Gespräch zu halten, ohne sie zu vernichten. Eine Gesellschaft wird nicht allein durch Gesetze und Institutionen offen, sondern durch ihre alltägliche Gesprächskultur.
Karl Popper hat 1945, im Schatten von Totalitarismus und Krieg, sein großes Werk Die offene Gesellschaft und ihre Feinde veröffentlicht. Darin verteidigt er Freiheit, Kritik und Pluralität gegen jene Kräfte, die Gesellschaften schließen und erstarren lassen. Heute, fast achtzig Jahre später, lohnt es, diesen Titel neu zu lesen: als Einladung, die „offene Gesellschaft“ nicht nur als politisches Prinzip zu begreifen, sondern als Haltung im Gespräch.
Denn was für Demokratien gilt, gilt auch für Konflikte, Familien, Organisationen: Offene Systeme leben davon, dass Menschen sich in Sprache begegnen – ohne Dogma, ohne den Anspruch auf absolute Wahrheit, ohne Angst vor Irrtum.
Die offene Gesellschaft beginnt nicht im Parlament, sondern im Gespräch zwischen zwei Menschen, die bereit sind, einander auszuhalten.
Historischer Resonanzraum
Popper schrieb sein Werk im Exil, in Neuseeland. Die Welt lag in Trümmern. Totalitäre Systeme hatten gezeigt, wohin Dogmatismus und Geschichtsglauben führen: in Gewalt und Unterdrückung. Popper benannte diese Systeme als „Feinde der offenen Gesellschaft“: Sie beanspruchten, das Rad der Geschichte zu kennen, und wollten Menschen in den Lauf eines angeblich unvermeidlichen Schicksals zwingen.
Seine Kritik galt nicht nur dem Faschismus, sondern auch dem Historizismus, wie er ihn bei Plato, Hegel oder Marx sah: der Glaube, dass Geschichte nach zwingenden Gesetzen verlaufe. Für Popper war dieser Glaube selbst schon eine Form von Geschlossenheit, weil er Freiheit und Offenheit der Zukunft negiert.
Warum ist das für uns heute relevant? Weil auch wir in Gefahr stehen, unsere Gesprächskultur zu schließen – nicht mehr bloß durch diktatorische Systeme, sondern durch digitale Echokammern, durch den Zwang zur schnellen Positionierung, durch die Abwertung anderer Sichtweisen. Auch hier entstehen kleine „geschlossene Gesellschaften“, in denen nur die eigene Wahrheit gilt.
Die offene Gesellschaft lebt nicht von der Größe ihrer Institutionen, sondern von der Weite ihres Gesprächsraums.
Offene Gesellschaft = Offenes Gespräch
Poppers Grundprinzipien lassen sich direkt auf Gespräche übertragen:
- Fehlbarkeit anerkennen. „Wir alle können irren.“ In Gesprächen ist das eine befreiende Haltung. Sie löst den Druck, Recht haben zu müssen, und schafft Raum für Annäherung.
- Kritikfähigkeit. Aussagen sind Angebote, nicht Dogmen. Wer Kritik zulässt, hält den Dialog offen.
- Stückwerk-Technologie. Annäherung geschieht in Etappen, nicht durch Heilspläne – sondern durch kleine Schritte, die Zukunft eröffnen.
Beispiel: In einer Mediation behauptet eine Partei: „So war es immer – und so wird es bleiben.“ Die andere Partei reagiert mit: „Und du bist schuld!“ Erst eine behutsame Frage des Mediators öffnet den Raum: „Was würde sich verändern, wenn wir diesen Punkt heute für einen Moment anders betrachten?“
Ein Gespräch bleibt offen, wenn es nicht von Wahrheiten lebt, sondern von tastenden Fragen.
Die Feinde der Offenheit im Gespräch
Popper sprach von den „Feinden“ der offenen Gesellschaft. Diese Feinde finden wir auch in alltäglichen Gesprächen:
- Dogmatismus. „So ist es, und nicht anders.“
- Historizismus. „Es war schon immer so.“
- Autoritarismus. „Sag uns, wie es ist.“ – das Verlangen nach einem starken Dritten.
Mediator:innen sind hier Hüter:innen der Offenheit: Sie schützen den Raum vor Dogma, Schicksalsglauben und Autoritätswünschen – nicht indem sie selbst die Wahrheit sprechen, sondern indem sie Bedingungen schaffen, in denen Unterschied stehenbleiben darf.
Die Feinde der Offenheit sind nicht nur Systeme, sondern Haltungen, die im Gespräch Raum besetzen.
Poppers Methode als Gesprächsressource – und die Kunst des Tastens
Der kritische Rationalismus ist im Kern eine Gesprächsmethode: Hypothesen bilden, prüfen, verwerfen, neu denken. In der Wissenschaft explizit, in der Mediation implizit – tastend, demütig.
Hypothesenarbeit in der Mediation ist eine Haltung des Nichtwissens, die auf Resonanz vertraut. Mediator:innen entwerfen ein Bild im Hintergrund – und prüfen es durch behutsame Fragen:
„Wenn ich Ihnen so zuhöre, klingt es, als gäbe es … – wie erleben Sie das?“
„Welche Rolle spielt dieser Punkt aus Ihrer Sicht?“
„Was würde geschehen, wenn wir das für einen Moment anders denken?“
Tastende Hypothesen sind wie Fühler ins Offene – sie spüren Möglichkeiten, ohne sie festzuschreiben.
Aktualisierung im Heute
Welche Feinde bedrohen die offene Gesellschaft heute – und damit unsere Gesprächskultur?
- Algorithmische Echokammern. Digitale Medien verstärken nur, was wir ohnehin glauben.
- Absolute Meinungen. Polarisierung erzeugt Gesprächsverweigerung.
- Gesprächsflucht. Rückzug statt Auseinandersetzung – auch in Form von Cancel Culture.
Die offene Gesellschaft stirbt nicht an Lärm, sondern an Gesprächsflucht.
Conclusio
Karl Popper hat mit seinem Werk die Freiheit gegen ihre Feinde verteidigt. Doch seine Botschaft wirkt über Politik hinaus: Sie ist ein Leuchtkegel für unsere Gesprächskultur.
Eine offene Gesellschaft entsteht nicht nur durch Parlamente oder Verfassungen. Sie beginnt dort, wo zwei Menschen einander aushalten, Kritik zulassen, Fehler eingestehen und gemeinsam Zukunft wagen.
Eine offene Gesellschaft lebt nicht von Einheit, sondern von der Fähigkeit, tastend im Gespräch offen zu bleiben.
Warum das Wesentliche nicht reproduzierbar ist – und gerade dadurch Zukunft schenkt
Ein Essay über Theater, Unverfügbarkeit und die Resonanz des Einmaligen.
Theater als Ereignis
Der Saal im Linzer Posthof ist voll an diesem Abend. Lars Eidinger tritt auf die Bühne, begleitet von Hans-Jörn Brandenburg am Klavier. Gemeinsam lassen sie Brechts Hauspostille erklingen – ein Werk, das schon in seiner Anlage zwischen Liturgie und Revolte schwankt. Doch es ist nicht Brecht allein, der diesen Abend trägt. Es ist Eidingers Art, immer wieder den Kontakt ins Publikum zu suchen, die Grenze zwischen Darstellendem und Betrachtendem aufzulösen, das Theater als lebendiges Geflecht von Blicken, Stimmen und Atemzügen sichtbar zu machen.
In einer dieser Interaktionen spricht er von der Besonderheit des Theaters. Nicht das Memorierte, nicht das Aufgezeichnete mache seine Wahrheit aus. Sondern das, was jedes Mal neu entstehe – durch die Anwesenheit, durch das Unerwartete, durch das unberechenbare Echo aus dem Publikum. Zur Bekräftigung zitiert er Sarah Kane:
“Theatre has no memory, which makes it the most existential of the arts.”
Unverfügbarkeit
In einer Welt, die alles aufzeichnen, speichern, wiederholbar machen will, erinnert uns dieser Satz an eine andere Wahrheit: Das Wesentliche bleibt unverfügbar. Wir können Technik anwenden, Räume bauen, Texte vorbereiten – doch ob sich im entscheidenden Augenblick etwas öffnet, bleibt jenseits unseres Zugriffs.
Unverfügbarkeit ist kein Mangel. Sie ist die stille Signatur des Lebendigen. Sie verweist uns auf eine Haltung: nicht alles zu beherrschen, sondern bereit zu sein, berührt zu werden.
Die Trias des Lebendigen
- Kontingenz – es könnte auch anders sein. Jede Begegnung ist offen, nicht abgesichert. Das schenkt Freiheit.
- Resonanz – etwas antwortet. Ein Wort, ein Blick, ein Schweigen ruft Echo hervor.
- Vulnerabilität – die Bereitschaft, sich zu zeigen. Ohne Risiko kein Verstehen.
Gegenwart als Kunstform
Theater hat kein Gedächtnis im Sinn von Wiederholbarkeit. Was bleibt, ist nur das Erlebte – in den Menschen, die dabei waren, nie jedoch als Kopie. Alles, was uns verwandelt, entzieht sich der Reproduktion. Gerade darin liegt seine Kraft.
Spuren statt Kopien
Unverfügbarkeit bedeutet nicht Leere. Sie hinterlässt Spuren – nicht als Kopie, sondern als Resonanz. In veränderten Blicken. In einer gelösten Anspannung. In einem Satz, der hängenbleibt.
Unverfügbarkeit bedeutet: nicht ich verfüge – sondern ich werde berührt.
Ein Resonanzmodell für Gesellschaft
So bleibt die Frage: Wie können wir mit Unverfügbarkeit leben – nicht nur im Theater, sondern auch im Gemeinsamen? Die Denkfigur der Admonter Raute erinnert uns daran, dass jeder Versuch, das Unverfügbare zu leugnen, in Erstarrung endet.
- Wer beim Klären im Eigenen steckenbleibt, verliert das Offene.
- Wer beim Selbst unreflektiert verharrt, verliert das Gegenüber.
- Wer im Zwischen das Gemeinsame scheut, verliert die Gestalt.
- Wer zu schnell gestaltet, verliert Tiefe und Weite.
Die drei Wege – Verstehen, Begegnen, Gestalten – werden so zu gesellschaftlichen Haltungen.
Epilog – Sehen, was noch nicht ist
Unverfügbarkeit anerkennen heißt auch: den Blick nicht nur auf das richten, was ist, sondern auf das, was noch möglich werden könnte. Wenn wir dem Augenblick Raum geben, öffnen sich Schwellen, die uns über das Gegebene hinausweisen.
Diese Bewegung – über das Jetzt hinaus zu sehen, ohne das Jetzt zu verdrängen – hat Jagoda Marinić in ihrer Eröffnungsrede zum Brucknerfest Linz eindrucksvoll beschrieben. Sie sprach davon, wie leicht wir uns im Dunkel der Krisen verlieren, und erinnerte daran, dass wir eine andere Aufgabe haben: das Sehen dessen, was noch nicht ist.
✨ Unverfügbarkeit anerkennen heißt: Schwellen nicht zu fürchten, sondern sie als Übergänge zu begreifen.
„Wirkung entfaltet sich nicht im Moment – sondern im Echo.“
Dieses Dossier ist Teil des Alumni-Netzwerks A_MKM.
Es will kein Archiv sein – sondern ein Resonanzraum zum Weiterdenken.